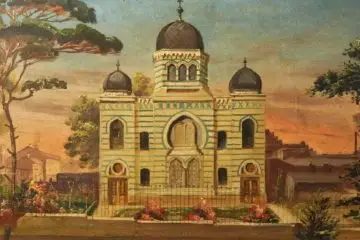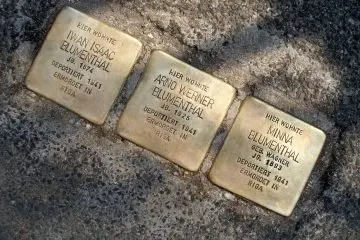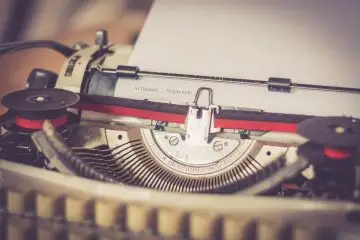Feste feiern: Jom Kippur
Versöhnungstag
Der Versöhnungstag (hebr. יוֹם הכִּפּוּרִים, Yom ha-Kippurim), ist ein Fasten- und Versöhnungstag, der am Zehnten des Tishri stattfindet. Er ist der Höhepunkt der”Zehn Tage der Buße” und der wichtigste Tag im liturgischen Jahr der Juden.
In der Tora
Am Versöhnungstag ist wie am Shabbat jede Art von Arbeit verboten, und die Seele soll “betrübt” werden (“vom Abend des neunten Tages des siebten Monats bis zum Abend des morgigen Tages”); die Strafe für die Übertretung dieser Gebote ist Vernichtung und Ausrottung (Lev. 16:29-31; 23:27-32; Num. 29:7). Es waren besondere zusätzliche Opfergaben zu bringen (Num 29,8-11), und außerdem wurde im Tempel eine dem Tag eigene Zeremonie abgehalten (Lev 16,1-34). Das Wesen des Tages und die Gründe für die Zeremonie werden in dem Vers ausgedrückt: “Denn an diesem Tag soll für euch Sühne geschehen, um euch zu reinigen; von allen euren Sünden sollt ihr rein sein vor dem Herrn” (Lev. 16:30). Im Jubiläumsjahr wird der Schofar am Versöhnungstag geblasen, um die Freilassung der Sklaven und die Rückgabe der Felder an ihre angestammten Besitzer anzuzeigen (Lev 25,9-10).
 In der Zeit des Zweiten Tempels
In der Zeit des Zweiten Tempels
Das Ritual, das der Hohepriester im Tempel vollzog, war das zentrale Element des Versöhnungstages. Es ist sicher, dass der Versöhnungstag bereits zur Zeit des Zweiten Tempels als das größte aller Feste galt. Es wird berichtet, dass keiner der Festtage Israels mit dem fünfzehnten Av und dem Versöhnungstag vergleichbar war, an denen die Töchter Jerusalems in weißen Kleidern auszogen und in den Weinbergen tanzten.
Halachische Implikationen
Nach Ansicht der Weisen gibt es fünf Arten, wie die Pflicht, die Seele zu betrüben, erfüllt werden kann: durch Verbote des Essens und Trinkens, des Sich-Waschens (zum Vergnügen), des Salbens des Körpers, des Tragens von Schuhen (aus Leder) und des Zusammenlebens. Die Strafe der Ausrottung gilt jedoch nur für Essen, Trinken und Arbeiten. Am Versöhnungstag sind die gleichen Arbeiten verboten wie am Shabbat, aber Lebensgefahr(pikku’aḥ nefesh) hebt alle Verbote des Versöhnungstages ebenso auf wie die des Shabbats. Kinder sind von allen Formen der Trübsal befreit, außer vom Tragen von Schuhen. Erst einige Jahre bevor sie das Alter erreichen, in dem sie verpflichtet sind, Gebote zu erfüllen (13 Jahre für einen Jungen und 12 Jahre für ein Mädchen), soll man beginnen, sie allmählich an die Einhaltung dieser Gesetze zu gewöhnen. Da der Versöhnungstag als “festlicher Tag” gilt, ist man verpflichtet, ihn durch das Tragen sauberer Kleidung zu ehren (Schab. 119a; siehe unten).
Nach Ansicht der Weisen sühnt die Ziege, die am Versöhnungstag im Rahmen des Tempelrituals nach Azazel geschickt wird, für alle Übertretungen, während nach der Zerstörung des Tempels der Tag selbst sühnt. Die meisten Weisen sind jedoch der Meinung, dass selbst die Sühne der Ziege nur für denjenigen wirksam war, der bereut hat, denn der Tag sühnt nur, wenn er von Reue begleitet wird (Yoma 8:8-9; vgl. Yad, Teshuvah 1:2-4). Daher rührt der Brauch, sich am Vorabend des Versöhnungstages gegenseitig um Vergebung zu bitten. Die Weisen sind der Meinung, dass das Schicksal eines jeden Menschen, das seit Rosch ha-Schanain der Schwebe ist, am Versöhnungstag endgültig entschieden wird, und deshalb sollte man während der Zehn Tage der Buße und besonders am Versöhnungstag Buße tun. Der Versöhnungstag ist die einzige der festgelegten Jahreszeiten, die in der Diaspora keinen zweiten Tag hat. Das liegt daran, dass es äußerst schwierig ist, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu fasten. Die Gesetze des Versöhnungstages blieben während des Mittelalters im Wesentlichen dieselben, wie in den Tagen des Zweiten Tempels und in der nachfolgenden der mischnäischen und talmudischen Zeit. Ergänzungen und Variationen waren auf den Bereich der Bräuche und Gebete beschränkt.
Gebete
Es war bereits in der Zeit des Zweiten Tempels üblich, den ganzen Tag, vom Morgen bis zum Abend, im Gebet zu verbringen. Der Versöhnungstag ist der einzige Tag im Jahr, an dem fünf *Amidah-Gebeteverrichtet werden. Dies ist vielleicht der Ursprung des muslimischen Brauchs, fünfmal am Tag zu beten. Die Gebete für den Versöhnungstag beginnen am Abend mit Kol Nidrei. Das Thema des charakteristischen mittleren Segens des Amidah-Gebetes am Versöhnungstag ist Gottes Vergebung, Verzeihen und Gewährung von Sühne für Israels Schuld . Die Gebete des Versöhnungstages und des Neujahrsfestes haben viele Gemeinsamkeiten, und zuweilen sind einige der Gebete, die dem Neujahrsfest eigen sind, in die Gebete des Versöhnungstages übergegangen.
Besonders charakteristisch für die Gebete am Versöhnungstag ist die Pflicht zur Beichte. Obwohl die Beichte “am Vorabend des Versöhnungstages kurz vor Einbruch der Dunkelheit” vorgeschrieben ist, wird sie sowohl vor der letzten Mahlzeit vor dem Fasten (“damit er beim Essen und Trinken nicht verwirrt wird”) als auch danach (“damit ihm während der Mahlzeit kein Missgeschick passiert”) sowie bei jedem der Versöhnungsgottesdienste gesprochen. Die Kurzform des Bekenntnisses (“Wir haben übertreten, wir haben treulos gehandelt” usw.) scheint bereits zur Zeit der Amoraim entstanden zu sein.
Bräuche
Viele Bräuche haben ihren Ursprung im Mittelalter, insbesondere bei den aschkenasischen Juden. So ist es üblich, den Tisch für den Vorabend des Versöhnungstages in der gleichen Weise zu decken wie am Shabbat, die Synagoge mit schönen Tüchern zu schmücken, weiße Kleidung zu tragen, entweder um den Engeln zu ähneln oder weil Weiß die Farbe der Leichentücher ist und somit zur Reue anregt, indem es den Tod heraufbeschwört. Dieser letzte Brauch verbreitete sich auch in Italien und in der Provence, und es wurde zu einem weit verbreiteten Brauch, ein weißes Gewand namens Kittel zu tragen. Sehr bedeutsam ist der Brauch, der in Deutschland in den Tagen der Toschafisten entstand und zum Gesetz wurde, zu Hause Kerzen anzuzünden und einen Segen über sie zu sprechen. Zusätzlich zu dieser Kerze und zu derjenigen, die (nach altem Brauch) angezündet wird, um das Zusammenleben zu verhindern, das an diesem Tag verboten ist, ist es an einigen Orten auch üblich geworden, eine Kerze für die Seelen der Lebenden anzuzünden und eine Kerze für die Seelen der Verstorbenen. Es wurde auch zum Brauch, “die Toten am Versöhnungstag zu erwähnen und zu ihrem Gedenken Wohltätigkeit zu spenden”
Vorabend des Versöhnungstages
Eine besondere Bedeutung kam dem Tag vor dem Versöhnungstag zu, der schon in der Zeit der Mischna und des Talmuds nicht nur als Vorbereitung, sondern als untrennbarer Bestandteil des Versöhnungstages angesehen wurde. Die Aussage: “Jeder, der am neunten [Tischri] isst und trinkt, wird von der Schrift so angesehen, als habe er am neunten und zehnten gefastet” bedeutet, dass man am Vorabend des Versöhnungstages nicht nur gut essen und trinken sollte, um sich auf das Fasten vorzubereiten, sondern auch, um das Gebot zu erfüllen, sich über den Festtag zu freuen und ihn zu ehren. Von alters her wurde an diesem Tag viel Fleisch, Geflügel und Fisch gegessen , wobei man weniger Zeit mit dem Studium und dem Gebet verbrachte. Nach und nach nahm der Vorabend des Versöhnungstages den Charakter eines Festes an, und manche Leute verzichteten an diesem Tag auf jegliche Arbeit. Es ist üblich, den Armen Geschenke zu schicken, und es ist Pflicht, einander um Vergebung zu bitten und sich gegenseitig zu besänftigen.
Beendigung des Versöhnungstages
Auch dem Ende des Versöhnungstages wurde ein besonderer Status zugewiesen, ähnlich dem des Vorabends. Während der geonischen Ära wurde der Brauch des Schofarblasens am Ende des Versöhnungstages übernommen.
Warum ist der Jom Kippur so bedeutsam?
In der Tora findet sich kein Hinweis auf Trauerpraktiken am Versöhnungstag. Jedoch im Buch der Jubiläen wird dagegen behauptet, dass der Versöhnungstag, der einzige Tag im Jahr, an dem allen, die vollkommen bereuen, Vergebung gewährt wird, an dem Tag eingeführt wurde, an dem Jakob vom Tod Josephs erfuhr und um ihn trauerte.
In der Spätantike war Philo von Alexandria der erste Autor, der sich eingehend mit der Bedeutung des Versöhnungstages befasste. Seiner Meinung nach ist er das größte aller Feste, da er sowohl ein Fest als auch eine Zeit der Buße und der Reinigung ist und die wahre Freude darin zu finden ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen vertrat Philo die Ansicht, dass wahre Freude nicht in übermäßigem Essen und Trinken, Schlemmen und Schwelgen, Tanzen und Musik zu finden sei, die in Wirklichkeit nur die niedrigsten Begierden und Lüste des Menschen wecken. Der Versöhnungstag ist im Gegenteil durch Enthaltsamkeit und Hingabe an das Gebet von morgens bis abends gekennzeichnet. Der Zweck des Fastens ist die Reinigung des Herzens der Menschen, die beten, ohne sich von körperlichen Begierden stören zu lassen, und ihren Schöpfer um Vergebung für ihre vergangenen Sünden und um seinen Segen für die Zukunft bitten. Philo bezeugt, dass alle, nicht nur die Frömmler, sondern auch diejenigen, die sich an anderen Tagen überhaupt nicht durch die Furcht vor dem Himmel auszeichnen, die Heiligkeit des Tages fürchten und ihn einhalten, wobei die Übeltäter mit den Guten im Kampf um die Unterwerfung der bösen Neigung zusammenstehen.
Auch die Weisen betrachteten den Versöhnungstag als das höchste Fest und den größten Tag des Jahres.. Ein Tag unvergleichlicher Freude, sowohl für Gtt, der ihn Israel in Liebe geschenkt hat, als auch für die Kinder Israels selbst, ist der ganze Zweck des Versöhnungstages, für diejenigen zu sühnen, die bereuen und ihre Schuld bekennen. Sogar jemand, der den Rest des Jahres fern von zu Hause war, versuchte, zu seiner Frau und seiner Familie zurückzukehren, um den Tag und das Mahl am Abend mit ihnen zu verbringen. Nach der Aggada ist der Versöhnungstag der Tag, an dem Moses die zweite Gesetzestafel gegeben wurde, und auch der Tag der Beschneidung Abrahams. Es gibt auch eine Tradition, dass es der Tag der Akedah, der Bindung Isaaks, ist. Es wurde gesagt, dass selbst wenn alle anderen Feste abgeschafft würden, der Versöhnungstag, an dem die Kinder Israels den Engeln gleichen, bestehen bliebe. Der Satan hat keine Macht, die Kinder Israels an diesem Tag anzuklagen. Die Versammlung Israels, die während des ganzen Jahres mit Sünden befleckt ist, wird am Versöhnungstag gereinigt, denn es ist ein Tag der Vergebung und der Verzeihung, und die Versöhnung wird sogar den völlig Gottlosen versprochen, die umkehren, denn ihr Schöpfer wünscht ihre Umkehr und freut sich sehr darüber. Der Versöhnungstag wird also nicht nur als Pflicht, sondern mehr noch als Recht angesehen; und neben dem Gefühl der großen transzendenten Entfernung zwischen dem Sünder und Gott manifestiert sich in nachdrücklicher Weise die Vorstellung seiner immanenten Nähe zu allen seinen Geschöpfen (“Du streckst deine Hand aus nach den Übertretern; deine rechte Hand ist ausgestreckt, um die reuigen Sünder zu empfangen”).
Im Mittelalter änderte sich der Charakter des Versöhnungstages als Freudentag und Festtag nicht, aber man betonte auch seinen Charakter als Tag des Gerichts und der Gerechtigkeit und als Stunde der “Unterzeichnung des Urteils”. Die mittelalterlichen Philosophen beschrieben den Versöhnungstag als einen Tag, an dem die Seele, von körperlichen Fesseln befreit, den Höhepunkt ihrer Vollkommenheit im Dienst G-ttes erreicht.
In den letzten Generationen ist der Versöhnungstag für viele Juden die letzte konkrete Verbindung zum Judentum geworden.
Wichtige Implikationen des Versöhnungstages
- Rituelle Reinigung des Tempels
Der Zweck des geschlachteten Stieres und des Ziegenbocks darin besteht, “das Heiligtum von Unreinheiten[mi-tumot] und Übertretungen zu reinigen”, und der des zweiten Ziegenbocks (Sündenbock) darin, alle ihre “Missetaten”(avonot) und “Übertretungen”(pesha’im) wegzutragen. Das hebräische Wort pesha’im, das in diesem Zusammenhang zweimal vorkommt, findet sich nirgendwo sonst im gesamten Priestergesetzbuch. Es wurde vermutet, dass dieses Wort aus der Welt der Politik entlehnt wurde, wo das Verb פשע(pasha) “rebellieren” bedeutet, und seine Anwendung auf das Ritual des Versöhnungstages würde auf eine weitere grundlegende Funktion der vorgeschriebenen ḥattat-Opfer hinweisen, auf die die Mischna anspielt: den Tempel und das Volk von ihren pesha’im, ihren rebellischen Sünden, zu reinigen. - Priesterliche Reinigung des Tempels
Am Versöhnungstag muss der gesamte Tempelkomplex gereinigt werden. Ein privates Reinigungsopfer wird für die Schegagah, die unbeabsichtigte Sünde, dargebracht (und für schwere körperliche Unreinheit, die auf natürliche Ursachen zurückzuführen ist. - Azalel-Ritus
Eine weitere Implikation besteht darin, dass die beiden Kategorien von Reinigungsopfern – das geschlachtete, dessen Blut das Tabernakel reinigt, und das lebendige, das die Sünden des Volkes sühnt – zwei untrennbare Teile eines einheitlichen Zeremoniells sind.
Reinigungsopfern – das geschlachtete, dessen Blut das Tabernakel reinigt, und das lebendige, das die Sünden des Volkes sühnt – zwei untrennbare Teile eines einheitlichen Zeremoniells sind.
Tempelreinigungen dominieren die kultische Landschaft in Israels Umfeld. Die alten Heiden fürchteten Unreinheit, weil sie ihr dämonische Macht zuschrieben. Unreinheit war eine ständige Bedrohung für die Götter selbst und für ihre Tempel, wie die vor den Eingängen von Tempeln und Palästen aufgestellten Bilder der Schutzgötter in Mesopotamien und Ägypten und vor allem die aufwendigen Reinigungsrituale zur Befreiung der Gebäude von Dämonen und zur Verhinderung ihrer Rückkehr zeigen. Das Alter und die Allgegenwärtigkeit des sogenannten Azazel-Ritus sind noch auffälliger. Statt das Böse durch Fluch oder Feuer zu vernichten, wurde es an seinen Ursprungsort verbannt (z. B. Unterwelt, Wildnis) wo es keinen Schaden anrichten konnte. So wurde der Sündenbock in die Wüste geschickt, die als unbewohnt galt, mit Ausnahme des Satyr-Dämons Azazel.
Reinigung des Volkes
Obwohl sich die Reinigungs- und Azazel-Riten des israelischen Versöhnungstages kaum von ihren nahöstlichen Entsprechungen unterschieden, erfuhr ihre Bedeutung eine Revolution. Wie Gelehrte festgestellt haben, sind die Riten diskret: Die geschlachteten ḥattat-Tiere reichen aus, um die Stiftshütte zu reinigen, aber das lebende ḥattat trägt die Sünden des Volkes fort. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Israel, das heilige Volk , braucht die gleiche Reinigung wie das Heiligtum, denn “sie sollen ihr Lager nicht verunreinigen, in dessen Mitte ich wohne” (Num. 5:3b). Außerdem ist hier die monotheistische Dynamik am Werk: Da die Welt der Dämonen für Israel nicht existiert, liegt die einzige Quelle der Rebellion gegen Gott im Herzen des Menschen, und genau dort muss ständig eine kathartische Erneuerung stattfinden.
Das Azazel-Ritual sieht vor, dass “Aaron seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks legen und über ihm alle Missetaten und Übertretungen der Israeliten bekennen soll, welche Sünden sie auch immer begangen haben, und sie auf den Kopf des Ziegenbocks legen soll; und er soll in die Wüste geschickt werden…” (Lev. 16:21).
 Normalerweise müssen die Handauflegung und das Bekenntnis vom Opfernden selbst vorgenommen werden, aber derjenige, der eine Pesha, eine rebellische Sünde, begangen hat, ist nach den priesterlichen Vorschriften vom Heiligtum ausgeschlossen und muss vom Hohenpriester vertreten werden. Das Amt des Hohenpriesters darf nicht als von sich aus wirksam angesehen werden; das Volk ist zwar von den Riten ausgeschlossen, muss sich aber dem Fasten und anderen Handlungen der Selbstverleugnung unterwerfen. Das verbale Bekenntnis des Hohenpriesters muss mit der Reue des Volkes einhergehen. So reinigt die Reue den Menschen, wie das ḥattat-Blut das Heiligtum reinigt. Wenn der Mensch nicht die erste Anstrengung zu seiner Selbstregeneration unternimmt, ist der Ritus von Azazel nutzlos. Auch kann seine Reinigung durch Reue keine oberflächliche Übung sein.[/caption]
Normalerweise müssen die Handauflegung und das Bekenntnis vom Opfernden selbst vorgenommen werden, aber derjenige, der eine Pesha, eine rebellische Sünde, begangen hat, ist nach den priesterlichen Vorschriften vom Heiligtum ausgeschlossen und muss vom Hohenpriester vertreten werden. Das Amt des Hohenpriesters darf nicht als von sich aus wirksam angesehen werden; das Volk ist zwar von den Riten ausgeschlossen, muss sich aber dem Fasten und anderen Handlungen der Selbstverleugnung unterwerfen. Das verbale Bekenntnis des Hohenpriesters muss mit der Reue des Volkes einhergehen. So reinigt die Reue den Menschen, wie das ḥattat-Blut das Heiligtum reinigt. Wenn der Mensch nicht die erste Anstrengung zu seiner Selbstregeneration unternimmt, ist der Ritus von Azazel nutzlos. Auch kann seine Reinigung durch Reue keine oberflächliche Übung sein.[/caption]
Diese ethische Leistung ist in der antiken Welt bisher einmalig. Zwar sieht das babylonische Neujahrsfest ein Ritual der Demütigung für den König vor, gefolgt von seinem Beichtgebet, doch im Gegensatz zum Hohepriester Israels, der in seiner Beichte alle Verfehlungen seines Volkes benennt, erscheint der babylonische König arrogant und selbstgerecht. Nur der Jude konnte sagen, dass “G-tt … der Reue die gleiche Ehre zukommen lässt wie der Unschuld von Sünden”.
Schließlich ist die Sühne durch Opfer nur für Sünden gegen die Gottheit wirksam. Dies gilt auch für den Versöhnungstag. Auch hier hat die Mischna die ethische Bedeutung erfasst: “Für die Sünden zwischen dem Menschen und Gott bewirkt der Versöhnungstag Sühne, aber für die Sünden zwischen dem Menschen und seinem Nächsten bewirkt der Versöhnungstag nur dann Sühne, wenn er seinen Nächsten besänftigt hat”. Dass dieses geistige Prinzip keine Neuerung der Rabbiner ist, sondern ihr Erbe aus biblischer Zeit darstellt, zeigt sich an seiner ausdrücklichen Präsenz im Ascham-Opfer, bei dem die Wiedergutmachung an den Menschen der opfermäßigen Sühne vor Gott vorausgehen muss.
Der Versöhnungstag selbst ist vielleicht nicht so alt wie seine einzelnen zeremoniellen Elemente. Im Unterschied zu allen anderen Festvorschriften, die das Datum vor dem Ritual angeben, wird hier allein das Datum erst am Ende genannt, und der Begriff” Versöhnungstag” fehlt. Es wurde vermutet, dass es Hinweise darauf gibt, dass sich ein ursprünglicher Ritus zur Reinigung des Heiligtums zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt an einem Tag im Jahr zu einem jährlichen Tag zur Reinigung des Heiligtums und zur Versöhnung einzelner Israeliten entwickelt hat. Da die Quellenanalyse umstritten ist, sind sich die Gelehrten nicht sicher, wann der Versöhnungstag entstanden ist. Elemente in den Ritualen des Tages weisen hethitische Parallelen auf, die auf ein hohes Alter hinweisen könnten. Die Rolle Aarons als Priester ist eher ein Indiz für eine späte Entstehung. Obwohl die ursprüngliche Figur des Aaron aus der vorexilischen Zeit stammt, haben Gelehrte seit langem festgestellt, dass Aaron in der prophetischen Literatur der vorexilischen Zeit nie als Priester bezeichnet wird. Hesekiel, der Priesterprophet des Exils, verleiht nur der priesterlichen Linie des Zadok Legitimität, weiß aber nichts von aaronidischen Priestern.
Ein weiteres Indiz für die Verspätung des Versöhnungstages ist sein Fehlen in den Festlisten von Exodus 23, 34 und Deuteronomium 16.
Die Belege aus Esra-Nehemia sind besonders bedeutsam, weil das Buch Rosch ha-Schana und Sukkot erwähnt, aber den Versöhnungstag auslässt. Da der Autor von Esra-Nehemia sicherlich einen Großteil der priesterlichen Quelle kannte, ist der Versöhnungstag höchstwahrscheinlich Teil der letzten Schicht dieser Quelle.
[S. David Sperling DAY OF ATONEMENT, in: Encyclopaedia Judaica, Vol. 5, 2. Aufl., S. 488-493]