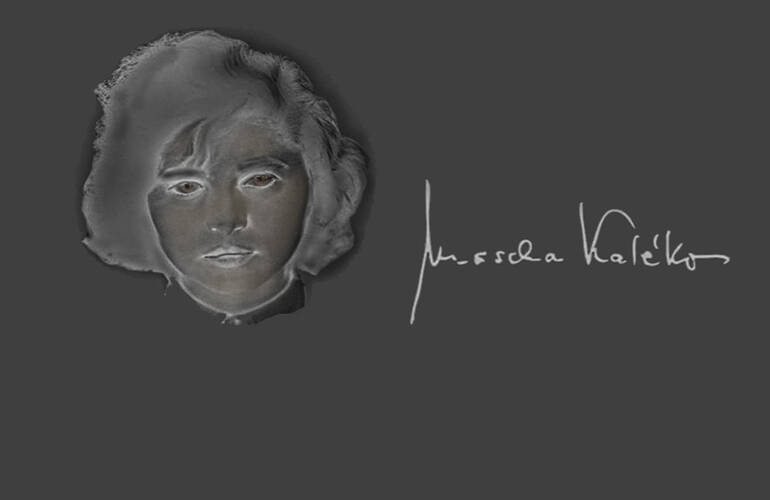Vor einem halben Jahrhundert verstarb Mascha Kaléko (1907–1975), deren poetisches Schaffen bis heute eine bedrückende Aktualität aufweist.
Die letzte Lektüre Kalékos soll sich auf die Biografie von David Bronsen über Joseph Roth bezogen haben. Dieser österreichische Schriftsteller, ebenfalls in Galizien geboren, ließ ebenfalls seine ostjüdische Herkunft im Unklaren. Jutta Rosenkranz erläutert in ihrer 2007 publizierten Biografie über Kaléko, dass deren Stimme kurz vor ihrem Tod als „erschütternd winzig“ beschrieben wurde. Diese charakteristische Beschreibung hinterlässt einen verstörenden Eindruck, insbesondere für jene, die durch alte Tonaufnahmen mit Kalékos Rezitationen ihrer Gedichte vertraut sind.
Kalékos Stimme war stets zart und ausgesprochen jugendlich. Ihr Lebensweg endete am 21. Januar 1975 in Zürich, wo sie auf dem Israelitischen Friedhof Friesenberg ihre letzte Ruhestätte fand.
Kindheit und Prägungen
Mascha Kaléko erblickte in einer anderen Zeit das Licht der Welt: als Golda Malka Aufen, die älteste Tochter eines russischen Vaters und einer österreichischen Mutter, am 7. Juni 1907 im heutigen Chrzanów, Südpolen. Ihre Eltern, Rozalia Chaja Reisel Aufen und Fischel Engel, waren zu diesem Zeitpunkt lediglich jüdisch verheiratet, weshalb die Tochter als unehelich galt. Erst im Alter von 15 Jahren legitimierte das Paar ihren Status, was zur Namensänderung in Mascha Engel führte. Zu diesem Zeitpunkt lebte die Familie bereits in Berlin, nachdem sie ihre westgalizische Heimat, mit der die Tochter gravierende Erinnerungen verband, hinter sich gelassen hatte.
Kalékos lyrisches Werk ist stark von den Themen Heimat, Verlassenheit und dem Verlust des Vaters geprägt. Letzterer wurde 1914 aufgrund seiner russischen Staatsangehörigkeit inhaftiert, was die junge Mascha nachhaltig beeinflusste. In ihren späteren Arbeiten reflektierte sie: „Ein Fremdling bin ich damals schon gewesen. / Ein Vaterkind, der Ferne zugetan …“
Die Flucht zahlreicher ostjüdischer Familien vor Pogromen führte auch die Familie Aufen-Engel über Frankfurt am Main und Marburg letztlich nach Berlin. Dort sollte Kaléko, wie ihre Biografin Rosenkranz feststellt, schließlich ihr Gefühl für Heimat entwickeln, während sie in anderen Großstädten zunächst Widerstände erlebte.
Exil
In der Folge führte sie ihr Weg nach New York und danach nach Jerusalem. Der Zweite Weltkrieg, das Exil und persönliche Herausforderungen prägten ihre Sichtweise und wurden in ihren Werken verarbeitet, welches sie in einem Gedicht als unvermeidlich bezeichnete. In ihrem literarischen Schaffen war Kaléko fähig, die Komplexität des Großstadtmenschen messerscharf zu erfassen und dabei Raum für sprachliche Erkundungen zu schaffen.
Doch nicht ohne Herausforderungen fand sie zu ihrer lyrischen Ausdrucksform. In einem Radiointerview im Jahr 1971 schilderte sie den Prozess des Schreibens als einen Wechsel zwischen Leichtigkeit und Schwierigkeiten: „Manchmal ganz leicht. Manchmal gar nicht. Korrigieren tu’ ich natürlich auch. Es kann auch sein, dass ein Gedicht jahrelang liegen bleibt.“
Kalékos schriftstellerische Anfänge fielen in eine Zeit, in der Berlin sich zu einem kulturellen Zentrum entwickelte. Nach dem Abschluss der Mittleren Reife arbeitete sie im „Fürsorgeamt der jüdischen Organisationen Deutschlands“ und verbaute in ihrem Prosatext „Mädchen an der Schreibmaschine“ (1934) Einblicke in die Alltagsrealität weiblicher Angestellter jener Zeit.
Literarische Erfolge und Anerkennung
Im Alter von 22 Jahren publizierte Kaléko ihre ersten Gedichte im »Der Querschnitt«. Diese Arbeiten brachten sie in Kontakt mit der Berliner literarischen Szene. Ihre Gedichte wurden oft als „weiblicher Ringelnatz“ oder „weiblicher Kästner“ bezeichnet, und sie verstand es, spielerisch ironische Tonlagen in ihre Werke zu integrieren, während sie gleichzeitig die Ernsthaftigkeit ihrer Themen nicht aus dem Blick verlor.
Trotz ihres Erfolges sahen sich Kalékos Texte oftmals dem Vorwurf ausgesetzt, sie seien simpel und trivial. Kalékos bewusste Wahl, ihre Biografie und literarische Entwicklung teilweise zu verbergen, einschließlich der Diskretion über ihre frühesten Publikationen, verstärkte diesen Eindruck. Dennoch fanden ihre Werke großen Anklang und wurden mehrfach veröffentlicht, darunter 1933 „Das lyrische Stenogrammheft“ und darüber hinaus „Kleines Lesebuch für Große“.
In ihren Gedichten thematisierte sie alltägliche Lebensrealitäten und die streben nach Identität nicht nur in der städtischen Umgebung, sondern auch im Kontext gesellschaftlicher Umbrüche. Die Literaturkritik nahmen ein zwiespältiges Verhältnis zu ihren Arbeiten ein, obgleich sie als bedeutende Stimme der Neuen Sachlichkeit eingestuft wurde.
Späte Jahre und Vermächtnis
Die dunkelsten Kapitel ihres Lebens erlebte Kaléko in den 1930er Jahren, als ihr Werk auf die schwarze Liste gesetzt wurde. 1939 emigrierte sie schließlich mit ihrem zweiten Ehemann Chemjo Vinaver und ihrem Sohn Steven nach New York.
Ihre späten Werke wie „Verse für Zeitgenossen“ (1958) und „Das himmelgraue Poesie-Album“ (1968) reflektieren den Verlust ihrer Heimat in Deutschland und konfrontieren die Leser mit ihrer melancholischen Erinnerung an Berlin und den Erfahrungen in ihrer neuen Heimat.
Nach ihrem Umzug nach Jerusalem 1959 kam es zu tragischen Verlusten in ihrem Leben. Der Tod ihres Sohnes Steven und später ihres Mannes führte zu einem künstlerischen Rückzug, der durch ihre gesundheitlichen Probleme weiter verstärkt wurde. Kalékos letzter Wille, durch den sie sich als „Dichterin“ auf ihrem Grabstein verewigte, verweist auf ihr Bewusstsein über die Relevanz ihres literarischen Schaffens, welches in den kommenden Generationen rezipiert werden würde. Die Reflexion über die zeitliche Relativität des menschlichen Daseins, wie in ihren Verszeilen zusammengefasst, bleibt als zentraler Punkt in Kalékos Werk bestehen: „Bedenkt: den eigenen Tod, den stirbt man nur, / Doch mit dem Tod der anderen muss man leben.“