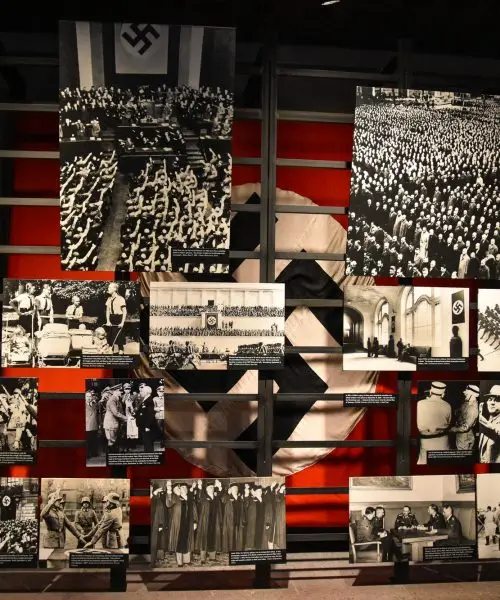In der NS-Zeit war die renomierte Landesanstalt, auf deren Gelände sich heute die Gropius-Klinik für Neurologie und Psychiatrie befindet, maßgeblich an Sterilisationen und den Massenvernichtungen im Rahmen der sogenannten T-4-Aktion beteiligt. Mit Dr. Gallus, der am 6. Februar 1934 in den Ruhestand versetzt wurde und seinem Nachfolger Dr. Benno Otto, dem Direktor der Landesfrauenklinik Berlin-Neukölln, begann gewissermaßen eine Übergangszeit im Amt der Leitung der Landesanstalt Eberswalde. Schon im Sommer 1934 signalisierte Dr. Otto eine Überbelastung, die wohl auch mit den jetzt in seiner Klinik vorzunehmenden Sterilisierungen zu tun hatte. Immer häufiger war sein Stellvertreter Baumann gefragt. Da er aber immer noch in Sorau wirkte und die Verkehrsanbindung nach Berlin relativ schlecht war, musste, wenn das Amt kontinuierlich geführt werden sollte, Abhilfe geschaffen werden. Landeshauptmann Dietlolf von Arnim-Rittgarten unterbreitete der Ärztekammer am 19. September 1934 den Vorschlag, den Direktor der Landesanstalt Sorau, Dr. Friedrich Baumann, auf Grund der besseren verkehrstechnischen Anbindung an Berlin als Direktor nach Eberswalde zu versetzen und ihn zugleich als ehrenamtlichen Landesmedizinalrefenten einzusetzen. Diesem Vorschlag wurde am 1. Februar 1935 entsprochen. Baumann wurde eine der wichtigsten Personen bei der Umsetzung der nationalsozialistischen Rassenpolitik in der Provinz Brandenburg. Ab Oktober 1940 wird Baumann das Amt des Landesmedizinaldirektors hauptberuflich ausüben. Die Nachfolge im Amt als Anstaltsdirektor in Eberswalde übernahm Dr. Heinrich Ehlers, der am 10. Oktober seine Direktorentätigkeit in Teupitz beendet hatte.
Die Berichte der Landesanstalt Eberswalde wurden ab Ende 1935 vom neuen Landesmedizinalrat und Anstaltsdirektor Dr. Friedrich Baumann abgefasst. Fast überschwänglich liest sich seine erste Einschätzung für die Konferenz der Anstaltsleiter vom 15. Januar 1936: „Die bisherigen Erfahrungen mit dem Erbgesundheitsgesetz sind recht gute gewesen, wenn auch bemängelt werden muss, dass das Verfahren noch zu lange Zeit dauert, so dass die für die Sterilisation in Frage kommenden Kranken länger als nötig in der Ausfall verbleiben müssen und dadurch der öffentlichen Fürsorge unnötige Kosten verursachen“. Im Jahresbericht! der Landesanstalt für das Jahr 1936 vermerkte er, dass die Beschäftigung mit dem „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ den Ärzten außerordentlich viel Arbeit machen würde. Die Kritik bezog sich allerdings lediglich auf den vermehrten schreibtechnischen Aufwand. Bis Dezember 1939 wurden von 2157 gestellten Sterilisationsanträgen 1856 vom Erbgesundheitsgericht entschieden und durchgeführt. Für die Sterilisierungen der Männern war ab Januar 1934 Dr. Meyer zuständig. Ab 1. April 1936 kam Dr. Otto Hebold von der Landesanstalt Teupitz nach Eberswalde und übernahm für Meyer die Sterilisierung der männlichen Patienten.
Der Psychiater Otto Hebold wurde am 27. Juli 1896 in Berlin geboren. Er trat 1933 in die NSDAP und in die SA mit dem Dienstgrad Sanitätssturmführer ein, 1936 wurde er Oberarzt an der Anstalt Eberswalde. Ab April desselben Jahres fiihrte er die Sterilisationen an dieser Anstalt durch. Im Januar 1940 wurde er Abteilungsarzt im Reservelazarett Berlin-Buch und in der Klinik des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Hirnforschung. Seine Tätigkeit als » T4«-Gutachter währte von April 1940 bis April 1943, wobei er gleichzeitig für Selektionen durch die »T4«-Zentrale zuständig war: Zusammen mit Heyde, Nitsche, Mennecke, Schmalenbach, Schumann, Lonauer, Muller, Steinmeyer, Wischer und Ratka beteiligte sich Hebold an der Häftlingsermordung unter dem Aktenzeichen »14f13« (Vgl. Schulze, Bernburg, S. 200; Joachim S. Hohmann/Günther Wieland, MfS-Operativvorgang „Teufel“. „Euthanasie“-Arzt Otto Hebold vor Gericht, Berlin 1996.). Im Rahmen der Forschung an »Euthanasie«-Opfern bot Hebold dem Heidelberger Psychiater Carl Schneider unter anderem einen »schönen Hydrocephalus, ganz primitiv und tiefstehend,« an.(Heidelberger Dokumente, zit. n. Klee (1985), »Euthanasie«, S. 398. ) Bei der Diskussion um den Umgang mit den nach § 42 StGB untergebrachten Patienten, von denen im Frühjahr 1944 die meisten in die Konzentrationslager verlegt wurden, denunzierte er zwei verbliebene Kriegsdienstverweigerer, die »nur polizeilich« eingewiesen waren, als »feine Herren«, die sich in der Anstalt einen faulen Lenz machten, und forderte: »Diese im KL. unterzubringen, würde eigentlich das Gebot der Stunde sein, damit sie auch etwas energischer etwas vom Krieg zu merken bekommen.«17 Im Jahr 1943 stieg Hebold zum stellvertretenden Direktor der Anstalt Eberswalde auf. Im April 1944 arbeitete er im Lazarett Brandenburg-Görden. Nach der Befreiung praktizierte er als Allgemeinmediziner in der DDR, wurde 1962 Sanitätsrat und Leiter des Landambulatoriums Falkenburg im Bezirk Cottbus. 1964 wurde er verhaftet und am 12. Juli 1965 in Cottbus zu lebenslanger Haft verurteilt. Dort starb Otto Hebold am 4. Januar 1975.
Zu den aussagekräftigsten Dokumentenfunden im Hinblick auf die Rekonstruktion der Arbeitsweise der »T4« zahlt eine »Kriminalpolizeiliche Ermittlungsakte«, die im Reichskriminalpolizeiamt (RKPA) anlässlich des Verschwindens von Wertgegenstanden aus dem Besitz einer getöteten Patientin angelegt wurde.(BAB, R 179/5619.) Die 52jährige Gertrud R. war am 24. Juli 1940 durch die Transportabteilung der »T4« von der Landesanstalt Eberswalde in die Tötungsanstalt Brandenburg verlegt und dort ermordet worden. Der geschiedene Ehemann erhielt die Todesnachricht allerdings nicht aus Brandenburg, sondern von der angeblichen »Landespflegeanstalt« Hartheim, die er anschließend um Übersendung des Nachlasses bat. Sein Insistieren veranlasste die » T 4« schließlich, das RKPA mit Untersuchungen über den Verbleib der vermissten Schmuckstucke zu beauftragen. Die in der Ermittlungsakte überlieferte interne Korrespondenz dokumentiert in unverschleierter Sprache den verwaltungstechnischen Aufwand, der fur die Erfassung der » Euthanasie«-Opfer und die Geheimhaltung ihrer Ermordung betrieben wurde. Wörtlich heißt es in einem internen Schreiben des stellvertretenden Leiters der Büroabteilung, Alfred Schüppel, an den Leiter der Hauptwirtschaftsabteilung, Willy Schneider, am 30. Oktober 1940: »Beiliegend überreiche ich in der Nachlasssache Gertrud R. die Z.-Akte Nr. 24127, die Krankenakte der Brandenburgischen Landesanstalt Eberswalde [ … ] und die Krankenakte C 5950 der Landesanstalt Hartheim zur Kenntnisnahme und weiteren Bearbeitung in eigener Zuständigkeit. Die Kranke Gertrud R. [ … ] wurde aus der Landesanstalt Eberswalde in die Landes-Pflegeanstalt Brandenburg a. H. verlegt, dort am 24. Juli 1940 erledigt und von der Landes-Pflegeanstalt Brandenburg a. H. nach der Landesanstalt Hartheim zur Beurkundung weitergegeben.« Dieser kurze Auszug beleuchtet schlaglichtartig zentrale Punkte in der Organisation und Abwicklung der Krankenmorde. Im vorliegenden Falle war die Patientin Gertrud R. von der Anstalt Eberswalde zunächst in die Tötungsanstalt Brandenburg verlegt und dort »erledigt«, d. h. ermordet worden; anschließend hatte man ihre Krankenakte an die Tötungsanstalt Hartheim zur »Beurkundung« weitergereicht. Diese Einrichtung sollte als offizieller Sterbeort den Schriftverkehr mit Angehörigen und Behörden fuhren. Mit der Weitergabe der Akten sollte der tatsachliche Tötungsort verschleiert und auffällige Häufungen von Sterbefällen in einer bestimmten Anstalt vermieden werden. Ein solches Täuschungsmanöver erschien insbesondere dann notwendig, wenn mehrere der getöteten Patienten aus derselben Wohngegend stammten. Die gehäuften Todesmeldungen hätten zu Unruhe in der Bevölkerung führen können. In einem weiteren
Dokumentenfund wird dieses Motiv ausdrücklich genannt. Mit Schreiben vom 27. April 1940 bat der Verwaltungsleiter der brandenburgischen Tötungsanstalt, Fritz Hirche, den Geschäftsführer der Verwaltungszentrale, Gerhard Bohne, die beiliegende Krankenakte von Jakob E. an »C« weiterzuleiten. Als Grund gab er an, dass Jakob E. gemeinsam mit seinem Vetter Otto E. in Brandenburg »in Dauerbehandlung genommen« worden sei: »Weil beide aus Köln sind, ist es nicht gut angängig, in beiden Fällen die Benachrichtigung der Angehörigen von hier herauszugeben«.(BAB, R 179/5798.)