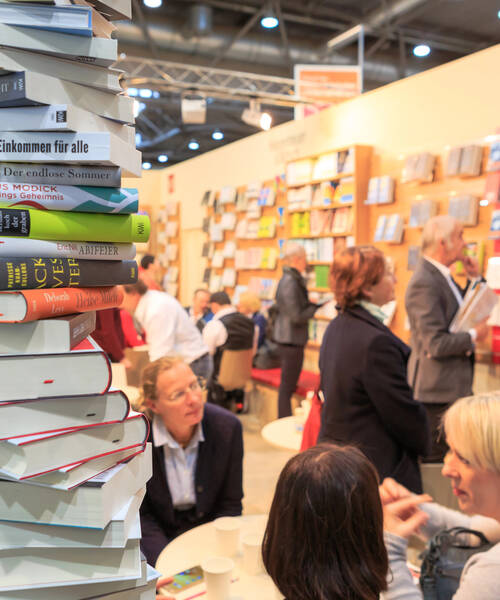Das Phänomen der Verschwörungstheorien hat einen besonderen Stellenwert im antisemitischen Kontext. Nicht alle Verschwörungsmodelle haben antisemitische Motive. Diese sind aber oftmals strukturell anschlussfähig für antisemitische Modelle. Bei der Analyse des Verschwörungsdenkens sind verschiedene Ideen und Erklärungen zu erkennen und zu berücksichtigen.
Ein psychologischer Aspekt vermittelt den Glauben, dass Verschwörungstheorien sinnstiftend sind und Menschen in einer zunehmend undurchschaubaren Welt Orientierung und Halt geben können. Der Kontrollverlust in der realen Welt wird durch das Gefühl verdrängt, die individuelle Kontrolle wiederzuerlangen.
Verschwörungsideen bieten alternative Erklärungsmodelle, die den gängigen Interpretationen gegenüberstehen. Diese alternativen Modelle stützt sich oft auf komplexe Denkkonzepte. Diese sind schwer zu widerlegen. Gegenbeweise werden als Bestandteil der Verschwörung betrachtet.
In Zeiten von gesellschaftlichen Umbrüchen und Krisen können Verschwörungsmodelle nicht nur persönlichen Halt vermitteln. Die Zustimmung zu Verschwörungsmodellen führt zu einer Verschwörungsmentalität. Anhänger von Verschwörungsideen neigen dazu auch anderen Verschwörungstheorien zuzustimmen.
In Zeiten von Verunsicherung, Umbrüchen oder Krisen kann das Verschwörungsdenken aber nicht nur Individuen Halt bieten. Es wird auch ein dualistisches Weltbild präsentiert, in dem ein ewiger Kampf zwischen Gut und Böse existiert.
Verschwörungstheorien bieten mit stark vereinfachten Erklärungsmodellen Deutungen für sehr komplexe gesellschaftliche Phänomene. Strukturelle Bedingungen und Machtverhältnisse werden vernachlässigt. Damit ist es recht einfach, bestimmte Personen oder Gruppen für Missstände und Konflikte verantwortlich zu machen.
Mit Verschwörungsideen können bedrohliche und mächtige Akteure enttarnt werden. Gegen diese Schadensverursacher kann die Legitimation von Gewalt als Gegenwehr akzeptiert werden.
Verschwörungstheorien